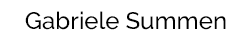Filme, die bewegen
Die Berlinale ist ein Publikumsfestival. Und so ist es nur folgerichtig, dass einer der spannendsten Preise in der facettenreichen Sektion Panorama seit 1999 vom Publikum bestimmt wird. Auch in diesemJahr wählten die Zuschauer erneut einen Film, der unsere Sicht auf dieWelt um eine berührende Perspektive erweitert, zu ihrem Lieblingsfilm: „Sorda“.
Eva Libertads „Sorda“ erzählt von Ángela, einer gehörlosen Frau, die mit ihrem hörenden Lebensgefährten Héctor ein Kind erwartet. Ángela wird von Miriam Garlo gespielt, der Schwester der Regisseurin, die selbst gehörlos ist. Das macht dieses Spielfilmdebüt zu einem nuancierten Seherlebnis, da die Schwestern ganz genau wissen, wovon sie erzählen.
Ángela und Héctor freuen sich sehr über die Schwangerschaft, wissen aber nicht, ob ihr Baby gehörlos oder hörend zur Welt kommt. Daher legt sich über ihre glückliche Beziehung allmählich ein leiser Schatten: Ihre Eltern und ihre hörenden Freunde sind sichtlich besorgt. Und dann wird bereits die Geburt für Ángela zu einem traumatischen Erlebnis, da das Personal im Stress immer wieder vergisst, dass sie auf das Gebärdendolmetschen ihres Mannes angewiesen ist, um den Anweisungen von Hebammen und Arzt folgen zu können.
Ein paar Wochen später erfahren sie durch einige Tests, dass ihre Tochter Maya ganz normal hören kann. Dadurch tut sich allmählich eine Kluft zwischen dem liebenden Paar auf, denn das Kind ist mehr auf Héctor fixiert, der mit ihr verbal kommunizieren kann. Man spürt Ángelas Angst, keine tiefe Bindung zu ihremKind aufbauen zu können, beinahe körperlich. Als die Lage Ángelas einen unerträglichenHöhepunkt erreicht, bedient sich die Regisseurin eines genialen Kniffs. Sie entfernt fast alle Geräusche, so dass der Zuschauer vollends in Ángelas Perspektive eintaucht. Als Tochter Maya gegen Ende des Film doch ihre erste Gebärde gelernt hat, freut man sich deshalb ganz besonders mit Ángela – und hat am eigenen Ohr erfahren, wie Inklusion Gehörloser besser gelingen kann.
Auch die außergewöhnliche Komponistin, Performerin und Vokalkünstlerin Meredith Monk hatte als Kind mit einer Einschränkung zu kämpfen: Sie schielte so stark, dass sie Probleme hatte, sich im Raum zu orientieren. Deshalb schickte ihre Mutter, eine Sängerin, sie zum Eurythmie- Unterricht. Seitdem waren für Monk Musik und Bewegung untrennbar miteinander verbunden. Billy Shebar porträtiert in seinem fesselnden Dokumentarfilm „Monk in Pieces“ mosaikartig Leben und Arbeit dieser Grenzen sprengenden Künstlerin, die Sänger wie Björk, Anohni, Kate Bush und David Byrne inspiriert hat und deren Musik in Filmen von Godard, Terence Malick, David Lynch und den Coen-Brüdern lief. Doch ihr Weg dahin war steinig, wie die Doku anhand von großartigem Archivmaterial aufzeigt, das Monk zur Verfügung stellte. Als weibliche Künstlerin in der von Männern dominierten Kunstszene New Yorks in den 1960er und 70er Jahren musste sie hart um Anerkennung und Finanzierung ihrer Stücke kämpfen.
Die Erforschung der menschlichen Stimme als Instrument beschäftigt die 82-Jährige mit den charakteristischen Zöpfen bis heute. Gegen Ende des Films sieht man aber auch, wie sie, die bei all ihren Stücken 60 Jahre selbst Regie geführt hat, dem Regisseur Yuval Sharon ihrMeisterwerk „Atlas“ anvertraut, damit er ihr Werk weiterführen möge. Der inspirierende Dokumentarfilm weckt große Lust, sich ihre Alben einmal in Ruhe anzuhören.
Die Knef in eigenenWorten
Ein weitererDokumentarfilm der Sektion Panorama huldigt einer anderen großen Künstlerin: Luzia Schmids „Ich will alles. Hildegard Knef“. Die Doku der Schweizer Regisseurin beginnt mit einem Auftritt der Knef 1968, bei dem sie ihren Chanson-Klassiker „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ präsentiert – und endet damit, wie die gealterte Überlebensexpertin dieses Lied noch einmal mit der gleichen Inbrunst vor großem Publikum performt. Dazwischen erleben wir eine hochbegabte Künstlerin, die oft hinfiel und immer wieder aufstand. Montiert hat Schmid die Doku größtenteils aus einer wahren Schatzkiste an Archivmaterial, oft hören wir,wie die scharfsinnige Knef für die damalige Zeit ungewöhnlich freimütige und kluge Interviews gab.
Schmid erzählt chronologisch von den Stationen in Knefs Leben, beginnend 1943, als das Kriegskind Schauspielunterricht nimmt. Über Nacht wird die 19-jährige dann 1946 zum Filmstar, als Wolfgang Staudte sie für die Hauptrolle in „DieMörder sind unter uns“ besetzt.David O. Selznick holt sie nach Amerika, dort lernte sie zwar Englisch, aberRollen bekam sie nicht – zu groß waren die Ressentiments nach dem Krieg. Hildegard Knef geht zurück nach Deutschland, wo sie 1950 im Melodram „Die Sünderin“ spielt – der Film wird ein Skandalerfolg, da sie sechs Sekunden lang nackt zu sehen ist. Dann noch einmal USA – mit dem Musical „Silk Stockings“ erobert sie den Broadway. Zurück in Berlin lernt sie ihren zweiten Mann, David Cameron, kennen, mit dem sie ihre Tochter Christina bekommt. Cameron treibt auch ihre Gesangskarriere voran. Zwischendurch befragt Schmid Knefs Tochter Christina, die ihre Kindheit und vor allem auch den Medikamentenmissbrauch ihrer Mutter durchaus kritisch sieht, sowie Hildes letzten Ehemann Paul von Schell.
Außerdem liest die Mannheimer Schauspielerin Nina Kunzendorf Passagen aus ihren autobiografischen Büchern vor, insbesondere aus dem 1970 erschienen Bestseller „Der geschenkte Gaul“. Und wieder staunt man, wie scharfsinnig diese Frau war – und wie weit ihrer Zeit voraus.Wie schön, dass die inspirierende Dokumentation auch in unsere Kinos kommt.
Shooting Star aus Mannheim
Eine hochbegabte junge Darstellerin, auch aus Mannheim, gab es in der Sektion Panorama ebenfalls zu bewundern: Die 26-jährige Devrim Lingnau spielt die Hauptrolle in dem verzwickten Rassismus-Drama „Hysteria“ und wurde dafür zu Recht als European Shooting Star ausgezeichnet.
In Mehmet Akif Büyükatalays zweiter Regiearbeit –mit „Oray“ gewann er 2019 auf der Berlinale bereits den Preis für den besten Erstlingsfilm – spielt sie die schüchterne, aber ambitionierte Regieassistentin Elif, die sich während der Dreharbeiten zu einem Arthouse-Film über den Anschlag in Solingen in ein Netz aus Lügen verstrickt.
Im Film im Film lässt der deutsch-türkische Regisseur Yigit den Anschlag von Solingen nachstellen, bei dem 1993 fünf türkischstämmige Menschen ums Leben kamen.Um dem ambitionierten Filmprojekt einen authentischen Anstrich zu geben, wurden als Komparsen Männer aus dem nahegelegenen Flüchtlingsheim engagiert. Doch die sind entsetzt, als sie entdecken, dass bei den Dreharbeiten ein echter Koran verbrannt wurde. Sowohl der tief religiöse FahrerMajid als auch der säkulare Theaterregisseur Mustafa fühlen sich in ihrer kollektiven Identität tief verletzt. Im Streit mit demRegisseur wirft Mustafa ihm einmal an den Kopf, dass sein Film von der Sorte sei, der lediglich „das Gewissen Europas“ beruhigen solle. Der Regisseur wiederum beruft sich auf die Kunstfreiheit. Zudem verliert Elif die Schlüssel zur Wohnung der Produzentin– Yigits Lebensgefährtin-, in der sie die Filmrollen sicher aufbewahren sollte. Auf einmal sind diese auch noch verschwunden.Wer steckt dahinter?
Büyükatalays Film hat hochinteressante Ansätze, ist eine wilde Mischung aus gesellschaftskritischem Kino und Paranoia-Thriller. Und auch wenn die Teile sich nicht völlig schlüssig zusammenfügen wollen, gibt der Film wichtige Denkanstöße für das Ringen um ein respektvolles Zusammenleben.
Große Bandbreite
Die Bandbreite des Panorama-Programms war auch in diesem Jahr wieder enorm. So gab die norwegische Regisseurin Emilie Blichfeldt ihr kultverdächtiges Langfilmdebüt mit einer tiefschwarzhumorigen Body-Horror-Version von Aschenputtel. Hier geht es grausamen Schönheitsidealen alles andere als zimperlich an den Kragen.
In „The Ugly Stepsister“ steht allerdings nicht Aschenputtel im Zentrum, sondern ihre Stiefschwester Elvira, die mit vollem Körpereinsatz von Lea Myren gespielt wird. Während die blonde Agnes dem gängigen Schönheitsideal entspricht, ist Elvira eher dicklich, hat schlechte Zähne und eine schiefe Nase. Da sie jedoch hoffnungslos in den oberflächlichen Prinzen verliebt ist, unterzieht sie sich unter der Rigide ihrer skrupellosen Mutter drastischen Schönheit-OPs.
Kein Film für schwache Gemüter, aber eine zeitgemäße Aschenputtel-Adaption in einer Ära, in der der Druck in den sozialen Medien so stark ist, dass immer mehr junge Mädchen sich für Schönheitskorrekturen entscheiden. Der wahre Horror lauert in der Wirklichkeit. Und viele der kompromisslosen Filme in der Panorama-Sektion hielten ihr wieder einmal bravourös den Spiegel vor.
Foto (c) 110th Street Films
In: Die Rheinpfalz / März 2025