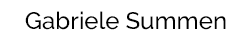Der große Beichtstuhl
In ihrem Roman „Junge Frau mit Katze“ führt die Rheinland-Pfälzerin Daniela Dröscher ihr Buch „Die Lügen meinerMutter“ gewissermaßen fort
Es gibt Bücher nach deren Lektüre ist man nicht mehr derselbe. Der vor drei Jahren für den Deutschen Buchpreis nominierte Roman der Rheinland-Pfälzerin Daniela Dröscher „Lügen über meine Mutter“, der zur Zeit verfilmt wird, gehört zweifellos dazu. Auch ihr neuer autofiktionaler Nachfolgeroman „Junge Fraumit Katze“ ist solch ein kleines literarisches Wunder. Die Erinnerungen der jungen Ich- Erzählerin im ersten Buch, das in den 1980er Jahren in einemDorf im Hunsrück spielt, kreisten um den Körper der mehrgewichtigen Mutter, die unter den Diätvorschriften und Demütigungen ihres Ehemanns litt.
Im neuen Werk steht nun Tochter Ela im Mittelpunkt. Sie wurde ebenfalls von einem zerstörerischen Körperbild geprägt und leidet selbst immer wieder unter diversen Krankheiten. Mit „angezogener, verschmitzter Melancholie“, wie die inzwischen erwachsene Ich-Erzählerin ihren Stil einmal nennt, erzählt sie, wie ihr Körper zu rebellieren beginnt: Was mit Halsschmerzen und dem sinnbildlichen Verlust ihrer Stimme beginnt, steigert sich zu Herzstolpern, heftigen allergischen Reaktionen und Gehirnnebel. Zunehmende Panik ergreift die Protagonistin, der bereits in jungen Jahren ein Tumor imKopf entfernt werden musste.
Eine zermürbende Odyssee durch unser Gesundheitssystem beginnt: Ela sucht immer wieder Ärzte auf, doch eine Diagnose bleibt lange aus. Der Allergologe ruft nach dem Test nicht zurück, Facharzttermine sind rar, und als Frau muss sie erleben, dass sogenannte Frauenkrankheiten wenig erforscht und sie häufig nicht ernst genommen wird. Wer selbst einmal ernsthafter krank war, erkennt sich in dem Aberwitz unseres überlasteten Systems wieder.
Zudem fällt Elas Therapeutin für einige Zeit aus. Mit ihr übt die junge Frau, die „in den Gesichtern der anderen…jede winzige Regung ablesen“ kann, am Gefühlsrad ihre eigenen Emotionen einzuordnen. Der Körperschatten ihrer Mutter schwebt stets unheilvoll über Ela. Diese leidet zwar selbst unter einer schmerzhaften Krankheit, hat aber begonnen, sich zu lösen und ist zu einer Pilgerreise aufgebrochen.
Ela arbeitet trotz aller Beschwerden in einemNebenjob an der Digitalisierung des Grimmschen Wörterbuchs – eine weitere Ebene, die dem Leser Sprachperlen wie „Lufthonig“ und „schneeglockengleich“ beschert. In einem lichtenMoment erkennt Ela, dass ihre Beschwerden auch mit ihrer Bildungskarriere zusammenhängen, die sie von der einst chancenlosen Mutter entfremdete. „Lernen, lesen und schreiben, waren in meinem Universum, lange Zeit untrennbar mit Schuld verknüpft … Es ist, als hätte mein Schreiben einen Preis. Als müsste ich es –mit demK örper bezahlen“, so Dröscher, die sich in all ihren Werken mit Klasse und Herkunft auseinandersetzt und den Vergleich mit Annie Ernaux nicht zu scheuen braucht.
So fühlt sich die Bildungsaufsteigerin Ela dem Hochstapler George Psalmanazar nahe. Der Franzose gab sich im 18. Jahrhundert als Ureinwohner Formosas aus, erfand ein Alphabet und schaffte es so bis in den Kreis der Gelehrten nach Oxford. Schreiben war auch ihmZuflucht und Selbstvergewisserung. Dass er im Roman auftaucht, ist kein Zufall: Sowohl imText als auch in Dröschers eigener Biografie wird er zur Schlüsselfigur, die sie dazu bewegt, dieWissenschaft aufzugeben und Schriftstellerin zu werden. Dröschers Erstling ist gerade übrigens unter dem Titel „Der falsche Japaner“ neu aufgelegt worden. Die Liebe der Autorin zur japanischen Kultur scheint immer wieder auch im neuen Roman auf. Den Kapiteln sind zudem Zitate der Japanerin Yoko Tawada vorangestellt, über die Dröscher promoviert hat.
Zu den eindrucksvollsten Nebenfiguren zählt der fürsorgliche Bruder, der sein Leben der Schönheit gewidmet hat – und zugleich unbewusst die Scham des Vaters über die mehrgewichtige Mutter übernommen hat. Auf seiner Hochzeit mit einem Japaner werden die Körper von Mutterund Tochter sich in einem poetischen Schlussbild miteinander versöhnen.
Zudem webt Dröscher literarische Bezüge zu Werken von Sylvia Plath, Susan Sonntag oder Siri Hustvedt über Körper und Krankheit ein. So entsteht eine eindringliche, dabei leise humorvolle Erzählung über die Einheit von Körper und Seele und unsere unselige Verstricktheit, aber auch Verbundenheit mit nahestehendenMenschen.
So gelingt es der Autorin aus dem Kreis Bad Kreuznach mit ihrem fein komponierten Werk abermals, die Möglichkeiten der Autofiktion so auszuloten, dass sich beim Leser jene Erweckungserlebnisse einstellen, die nur große Literatur auszulösen vermag.
Foto (c) Carolin Saage
In: Die Rheinpfalz / Oktober 2025