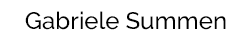Kein Entkommen
Mascha Schilinski spürt virtuos transgenerationalen Traumata auf einem norddeutschen Hof nach
Haben Sie sich je gefragt, wer wohl früher in Ihrer Wohnung, Ihrem Haus gelebt hat? Und ob die Leben dieser früheren Bewohner*innen unsichtbare Spuren hinterlassen haben, die bis ins Heute hineinwirken? Oder weniger esoterisch: Gehen Traumata – selbst solche, von denen man gar nichts weiß – womöglich auf folgende Generationen über? Genau diesen Fragen hat sich Mascha Schilinski gestellt. In ihrem zweiten Spielfilm „In die Sonne schauen“, der nach seiner umjubelten Weltpremiere in Cannes mit dem Preis der Jury ausgezeichnet wurde, entfaltet sie ein hypnotisches Generationendrama über weiblichen Schmerz, der sich durch ein ganzes Jahrhundert zieht. Dabei scheint es fast, als wäre der eigentliche Protagonist des Films der Handlungsort, ein abgelegener Vierseitenhof in der Altmark, der uns an einer Art gespenstischen „stream of conciousness“ teilhaben lässt:
Assoziativ verknüpfte Szenen, Träume, Blicke aus dem von Traumata und undefinierbarem Leid geprägten Leben unterschiedlicher Frauen spinnen uns ein. Da ist zum einen die siebenjährige Alma (Hanna Heckt), die mit ihren Schwestern in den 1910er Jahren auf dem Hof aufwächst. Ihre Kindheit ist vor allem von tragischen Ereignissen geprägt, die sie beobachtet, ohne sie ganz zu begreifen. So etwa, als ihr Onkel angeblich einen „Arbeitsunfall“ hat und ihm ein Bein amputiert werden muss.
Die Bauerntochter Erika (Lea Drinda) in der 1940er Jahren ist wiederum fasziniert von diesem einbeinigen Onkel. Die Teenagerin Angelika (Lena Urzendowsky), die in den 1980er Jahren auf dem Hof in der DDR lebt, entdeckt dagegen ihre weiblichen Reize, wird jedoch von ihrem Onkel und ihrem gleichaltrigen Cousin sexuell bedrängt. Ihre geistig stets abwesend wirkende Mutter scheint davon nichts mitzubekommen. In den 2020er Jahren wiederum wollen Lenka (Laeni Geiseler) und ihre Schwester Nelly (Zoë Baier) mit ihren Eltern dort einen unbeschwerten Urlaub verbringen. Doch die Geister der Vergangenheit scheinen in ihre Gegenwart hineinzuwirken und treiben die Mädchen in eine existentielle Krise – ein Zusammenhang, der allerdings rätselhaft bleibt.
Assoziativ springen Schilinski und Editorin Evelyn Rack immer wieder vor und zurück in der Zeit. Schilinskis traumwandlerischem Regietalent wird dabei kongenial von der Bildsprache ihres Lebensgefährten Fabian Gamper ergänzt. Seine Kamera geistert durch Räume, ganz nah an den Figuren, wechselt virtuos die Perspektiven. Dabei kreiert er Sequenzen, die teilweise an Hanekes verstörendes Historiendrama „Das weiße Band“ erinnern. Im streng gefassten 4:3-Format schafft Gamper Bilder, die sich tief ins Unterbewusstsein eingraben und noch lange im Kopf herumspuken. Auch das Sounddesign ist phänomenal, verstärkt Geräusche, als befände man sich permanent in einer Ausnahmesituation, in der der Hörsinn bis aufs Äußerste geschärft ist.
„Ich möchte lieber, dass die Leute einen Film fühlen, bevor sie ihn verstehen“ zitiert Filmemacherin Mascha Schilinski gern den Filmemacher Robert Bresson und setzt diesen Anspruch auf konsequente und beeindruckende Weise um.
Die Regisseurin, die bereits in ihrem Debüt „Die Tochter“ die emotionale Verstrickung einer Kleinfamilie eindringlich erfahrbar machte, droht allerdings in ihrem zweiten Werk das komplexe Innenleben ihrer Figuren immer wieder aus dem Blick zu verlieren. Als bestünde das Leben von Frauen ausschließlich aus Schmerz. Die ermächtigende Kraft von Sisterhood kommt in ihrem Kosmos leider gar nicht vor. So bewundernswert die formale Konsequenz und schauspielerische Wucht von „In die Sonne schauen“ ist – über eine Laufzeit von über zweieinhalb Stunden wird der konstante emotionale Druck zur Belastungsprobe.
Dennoch bleibt das Gefühl, etwas Außergewöhnliches gesehen zu haben, das einen so schnell nicht loslassen wird. Ein spektakulärer Film, der mutig mit neuen Formen des Erzählens experimentiert. Ein Film, den man sich mehr als einmal ansehen kann – in der Gewissheit immer wieder neue Facetten daran zu entdecken.
Foto (c) Fabian Gamper
In: Stadtrevue / August 2025